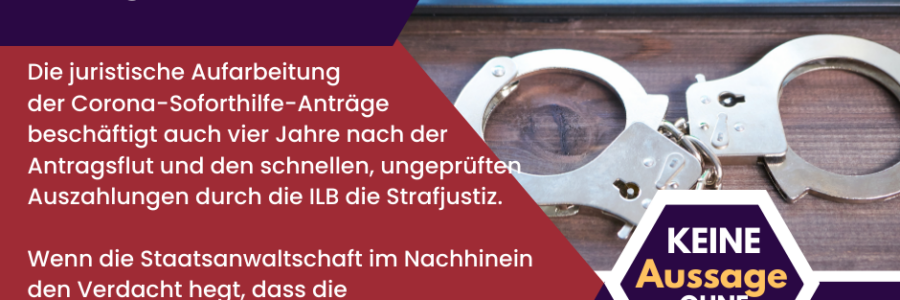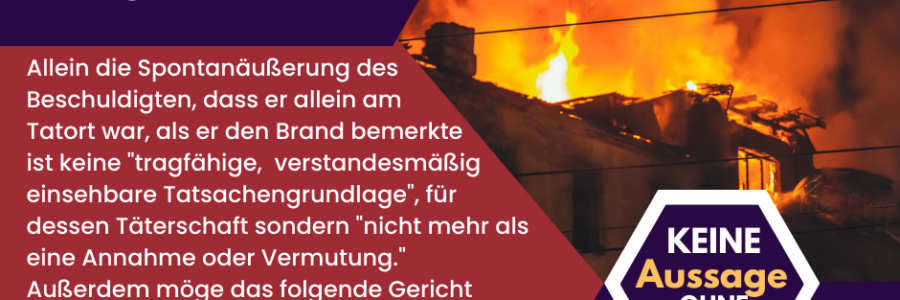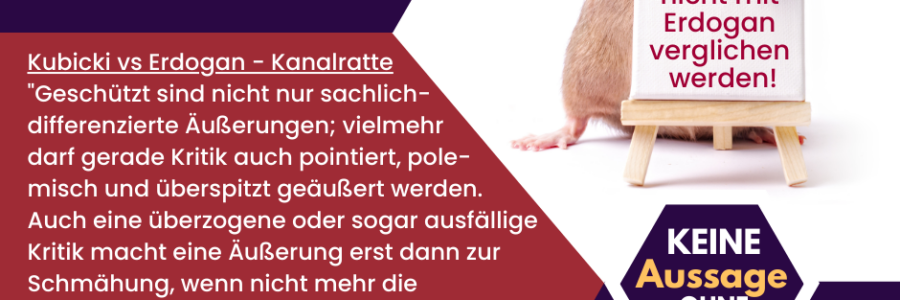Ich liebe den Verrat, aber hasse den Verräter
Ein Bonner Urteil, das die Republik erschüttert hat wie ein Cum-Ex-Sparplan den Bundeshaushalt: Dr. Kai-Uwe Steck, juristischer Architekt steueroptimierter Parallelwelten, wurde am 3. Juni 2025 wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Fünf Fälle. Ein Jahr und zehn Monate. Auf Bewährung.
Und das bei einem Steuerschaden in dreistelliger Millionenhöhe! Die Republik empört sich. Die „Bild“ tobt, das „Handelsblatt“ nennt das Urteil eine Farce. Und irgendwo in einem Finanzamt in Castrop-Rauxel weint ein Sachbearbeiter bittere Tränen auf die Lohnsteuererklärung eines Bäckermeisters.
Doch der Reihe nach.
Der Mann, der zu viel wusste
Kai-Uwe Steck war nicht einfach ein Mitläufer. Er war kein Azubi im Maschinenraum, sondern Konstrukteur des Antriebs. Als Wirtschaftsanwalt entwarf er die juristischen Schaltpläne, mit denen Banken und Investoren sich das Kapitalertragsteuerkarussell schönrechneten. Cum-Ex war sein Design.
Doch dann wechselte Steck die Seiten. Er wurde Kronzeuge. Und nicht irgendeiner. Er war das Sägeblatt, das die große Cum-Ex-Eiche fällte. Dank seiner Aussagen: hunderte Millionen zurück an den Staat, Verfahren gegen Hanno Berger und Christian Olearius. Steck sprach, und die Cum-Ex-Welt wankte.
Gesetz ist Gesetz
§ 46b StGB heißt das Zauberwort. Die Kronzeugenregelung. Wer entscheidend zur Aufklärung beiträgt, darf auf eine mildere Strafe hoffen. Oder sogar auf ein Absehen von Strafe. Auch bei Wirtschaftskriminalität. Auch bei Cum-Ex. Das ist kein Skandal, das ist Gesetz.
Das Landgericht Bonn hat dieses Gesetz angewendet. Es hat die rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung erkannt, es hat die Aufklärungsleistung gewürdigt, es hat die Milderung vorgenommen. Punkt.
Das Missverständnis von Gerechtigkeit
Die Empörung über das Urteil ist groß, weil sie mit einem fatalen Missverständnis einhergeht: Dass Strafe ein Racheakt sei. Doch moderne Strafjustiz will nicht rächen, sondern regulieren, motivieren, aufklären. Und manchmal auch: belohnen. Ja, belohnen. Nötig ist das, wenn es ohne die Hilfe des Täters keine gerechte Aufarbeitung gäbe.
Die Idee, dass ein Täter, der mitarbeitet, weniger bekommt als einer, der schweigt, ist kein Skandal. Sie ist ein strategisches Instrument. Wer Steck jetzt an den Pranger stellt, weil er 11 Millionen zahlte, aber 50 verdient hat, übersieht: Ohne Steck wären gar keine Millionen zurückgeflossen.
Verrat mit Ansage
„Ich liebe den Verrat, aber hasse den Verräter“ soll Kaiser Vespasian gesagt haben. Und wer einmal den Kommentar von Malte Vogtsmeier im Handelsblatt liest, versteht: Der Satz lebt. Steck hat das System verraten, das er einst selbst mitgebaut hat. Dafür wird er jetzt doppelt gehasst: als Täter und als Verräter.
Aber vielleicht sollten wir lieber die lieben, die den Verrat wagen. Auch wenn sie sich dabei nicht selbst vernichten. Wer Kronzeugen will, darf sie nicht ruinieren. Wer Aufklärung verlangt, muss mildernde Umstände anerkennen. Das Urteil ist kein Persilschein. Es ist ein Lehrbuchfall des § 46b StGB.
Und es ist ein Zeichen: Dass Gerechtigkeit mehr ist als Strafe. Nämlich auch Vernunft.
Aktenzeichen: LG Bonn, Urteil vom 3. Juni 2025, 63 KLs 1/22
Ausführliche Dokumentation auf der Webseite des sehr geschätzten Kollegen Dr. Strate https://strate.net/verfahren/strafverfahren-cum-ex-kronzeuge-landgericht-bonn/