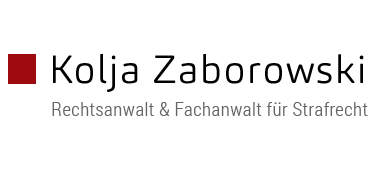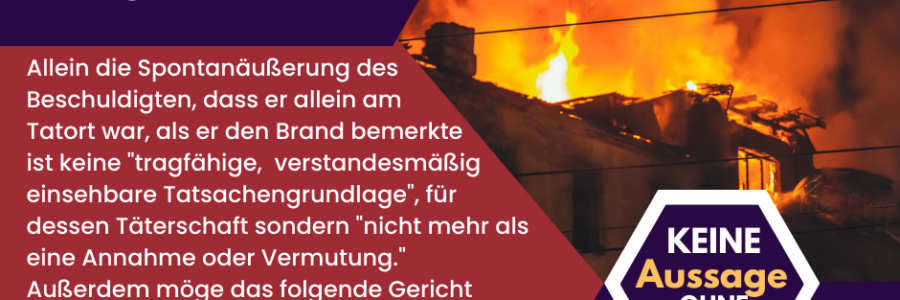Dem Mandanten wurde vorgeworfen, am 18.09.1987 einen Mord begangen zu haben. Ein typischer Cold Case. Er wurde aufgrund einer DNA-Spur am Kleid des Opfers verdächtigt und 2019 vom Landgericht Berlin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil wurde in der Revision vom Bundesgerichtshof aufgehoben und zur neuen Verhandlung an das Landgericht Berlin zurückverwiesen.
Nach elf Hauptverhandlungsterminen im zweiten „Durchgang“ wurde die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers gehalten. In den Schlussvorträgen erhalten die Verfahrensbeteiligten die Gelegenheit, die Beweisaufnahme zusammenzufassen, ihre Feststellungen darzulegen, zu würdigen und die entsprechenden Anträge zu stellen. Zuerst die Staatsanwaltschaft, dann die Nebenklage und zum Schluss die Verteidigung, bevor der Angeklagte noch einmal das „Letzte Wort“ hat.
Von besonderer Bedeutung war nach dem Vortrag des Staatsanwalts die Einlassung des Angeklagten, also dessen Stellungnahme zu den Vorwürfen der Anklage. Ich hatte für den Angeklagten in der ersten Beweisaufnahme eine schriftliche Erklärung verlesen. Diese wurde in der zweiten Beweisaufnahme erneut verlesen und später durch eine noch ausführlichere Stellungnahme ergänzt.
Der Staatsanwalt war entsprechend vorbereitet und hat sein schriftliches Plädoyer verlesen. Er beantragte, den Angeklagten erneut wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurteilen. Ein für ihn wichtiges Indiz, warum es sich bei der Einlassung des Angeklagten um eine reine Schutzbehauptung handele, sei, dass der Angeklagte seine Angaben hinsichtlich des Zeitpunktes des letzten Zusammentreffens mit dem Opfer geändert habe. In der ersten Beweisaufnahme hätte er noch behauptet, das letzte Treffen mit dem Opfer hätte am 13.09.1987 stattgefunden. Nun in der zweiten Beweisaufnahme behaupte er, das letzte Treffen müsse am 16. oder 17.09.1987 stattgefunden haben.
Eine derartige Änderung im Einlassungsverhalten könnte man tatsächlich negativ gegen den Angeklagten werten – soweit sind wir uns einig. Skandalös daran ist allerdings, dass der Staatsanwalt insoweit lügt. Es stimmt schlicht und einfach nicht. Der Angeklagte hatte sich in der ersten Beweisaufnahme nie dahingehend eingelassen, dass das letzte Treffen mit dem Opfer am 13.09.1987 stattgefunden habe.
Gut ist, dass es in der ersten Beweisaufnahme keine mündliche Einlassung gab, sondern eine schriftliche und das Beste an schriftlichen Einlassungen ist, dass man darin nochmal nachlesen kann, was genau erklärt wurde. Das Wort kann eben nur im Munde herum gedreht werden, aber nicht auf dem Papier.
Das Besondere an dem Datum ist nämlich, dass der Angeklagte am 13.09. Geburtstag hat und am 18.09. ein guter Freund von ihm. Anhand dieser Geburtstage und des Kalenders konnte noch eine grobe Erinnerung an die Zeit rekonstruiert werden. Sein Geburtstag fiel in dem Jahr 1987 auf einen Sonntag. Das letzte Treffen mit dem Opfer muss nach seiner Erinnerung in der ersten Beweisaufnahme an dem folgenden Mittwoch oder Donnerstag in der Woche stattgefunden haben. Dies stimmt also genau mit der Erklärung in der zweiten Beweisaufnahme überein.
Wenn der Staatsanwalt erklärt hätte, dass er dem Angeklagten nicht glaubt – geschenkt, das ist seine persönliche Beweiswürdigung.
Wenn der Staatsanwalt erklärt hätte, dass eine Erinnerung nach so langer Zeit ungewöhnlich ist – von mir aus, er soll glauben was er möchte.
ABER er sollte nicht behaupten, dass die Erklärung des Angeklagten in diesem für ihn wichtigen Punkt abweicht, wenn es nicht tatsächlich stimmt. Das ist eine Tatsachenbehauptung zu den (glücklicherweise) nachvollziehbaren Vorgängen in der Beweisaufnahme. Dabei falsche Tatsachen zu verbreiten, ist unseriös, manipulativ und mit Blick auf die möglichen Folgen einfach nur unverantwortlich.
Staatsanwälte genießen bei Gericht ein besonderes Vertrauen, manche haben dieses leider nicht verdient.
Ich habe es rechtzeitig bemerkt und in meinem Plädoyer klargestellt. Es handelt sich um eine entscheidungserhebliche Tatsache, bei der der Staatsanwalt dreist gelogen hat.
Der Staatsanwalt wurde von der Presse danach darauf angesprochen und hat versucht, sich dahingehend herauszureden, dass man die Einlassung aus der ersten Beweisaufnahme auch anders verstehen könne.
Das ist wieder gelogen. Die Aussage war absolut eindeutig.
Hat er bewusst gelogen und geglaubt, er käme damit durch, weil sich niemand mehr die erste Einlassung anschaut?
Am Ende stand für den Mandanten der verdiente Freispruch. Vielleicht hat die entlarvte Lüge des Staatsanwalts sogar geholfen, weil die Kammer erkannt hat, mit welchen Methoden er hier versucht hat, die Anklage zu retten.
Aber man male sich nur mal aus, die Einlassung des Angeklagten in der ersten Beweisaufnahme wäre nur mündlich erfolgt – wem hätte die Kammer wohl geglaubt?
Bertholt Brecht hat es mal auf den Punkt gebracht: „Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher!“