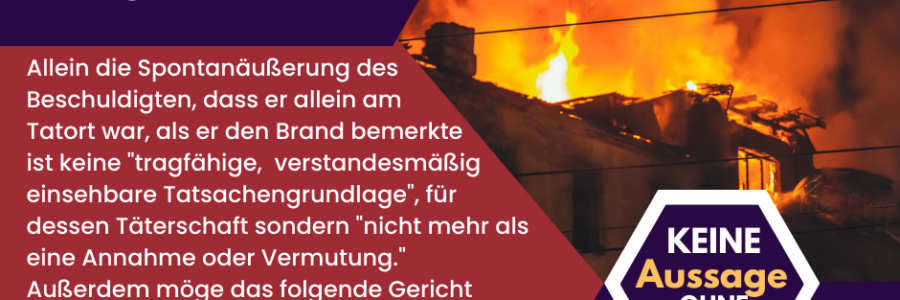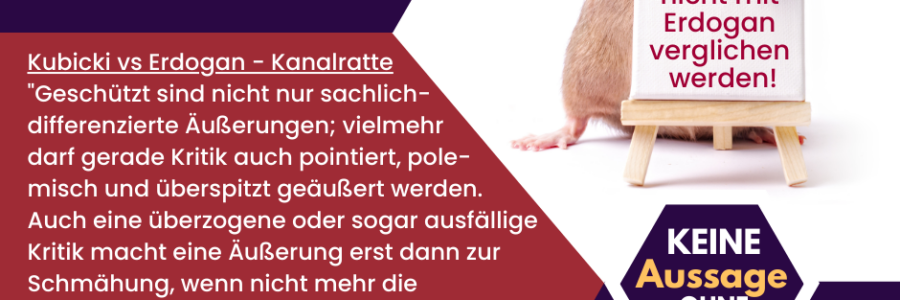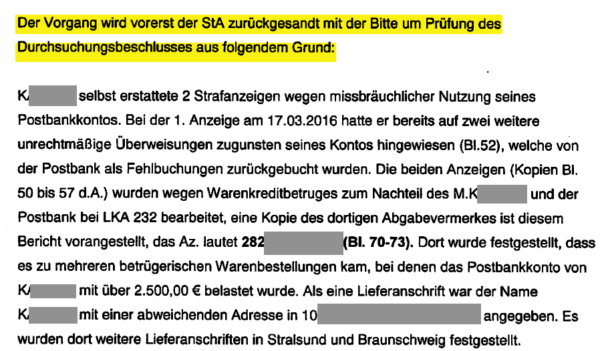Wer sein Haus anzündet, will vermutlich nicht mehr darin wohnen. Klingt banal, ist aber für die rechtliche Einordnung, ob es sich um eine schwere Brandstiftung handelt von entscheidender Bedeutung. Geschütztes Rechtsgut ist und bleibt die „Wohnstätte“ und wenn diese im Alleineigentum des Tatverdächtigen steht, kann er sich auch jederzeit dazu entscheiden, dass das dem Feuer geweihte Gebäude in alter Schabowski Manier „also ick sach ma ab sofort gilt das unverzüglich“ nicht mehr dem Wohnzweck dient.
Der Bundesgerichtshof hob das Urteil des Landgericht Frankenthal allerdings bereits aufgrund einer hanebüchenen Beweiswürdigung auf. Dem Angeklagten wäre eine unbedachte Spontanäußerung fast zum Verhängnis geworden. Dies bestätigt mal wieder die wichtigste Regel der Strafverteidigung: Schweigen ist Gold. Hier hat der Beschuldigte lediglich gegenüber einem Polizisten geäußert, dass er allein vor Ort war, als er den Brand bemerkte. Dies hat dem Landgericht ausgereicht, um davon auszugehen, dass der Angeklagte den Brand auch gelegt haben muss:
„Aus dieser Äußerung hat das Landgericht ohne nähere Begründung den Schluss gezogen, dass der Angeklagte die einzige Person gewesen sei, die sich im Zeitpunkt der absichtlichen Brandlegung vor Ort befand und daher allein als Täter in Betracht komme.“
Da staunt der Fachmann und der Zeuge fürchtet sich. Wenn dies zur Beweisregel erhoben werden sollte, dürften Zeugen, die nicht selbst als Tatverdächtige verfolgt werden wollen, zukünftig nur noch Brände melden wenn sie gleichzeitig andere Tatverdächtige benennen können. Die Qualität der Überzeugungsbildung bewegt sich damit ungefähr auf dem Niveau von: „Wer den Pups zuerst gerochen…“
Das zwischen dem Zeitpunkt der Brandlegung und der Brandbemerkung ein nicht unerheblicher Zeitraum liegen kann, dass der Angeklagte möglicherweise andere Personen schlicht nicht bemerkt hat oder ein technischer Defekt an den Stromleitungen, im Zählerkasten oder einem Küchengerät die Ursache des Brandes gewesen sein könnte, wird nicht weiter erörtert. Die konkrete Brandursache wurde nicht festgestellt. Auch der Zeitpunkt der vermeintlichen Brandlegung oder der Zeitpunkt des Bemerkens wurden nicht mitgeteilt. Objektive Spuren wie Brandbeschleuniger konnten offenbar nicht gefunden werden. Damit ist die Überzeugung von der Täterschaft nichts weiter als eine Vermutung. RUMMS – da ist also doch mal die Grenze überschritten, bei der die Revisionsinstanz die Beweiswürdigung des Landgerichts zerlegt, die doch eigentlich dem Tatrichter vorbehalten ist. Erörterungsmängel in dieser Qualität sind allerdings auch nicht so häufig anzutreffen.
Manche Formulierungen sind so elegant, die möchte man siezen:
„Die zur richterlichen Überzeugung erforderliche persönliche Gewissheit setzt objektive Grundlagen voraus, die den Schluss erlauben, dass das festgestellte Geschehen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Diese Überzeugungsbildung muss deshalb auf einer tragfähigen, verstandesmäßig einsehbaren Tatsachengrundlage beruhen und erkennen lassen, dass die vom Tatgericht gezogenen Schlussfolgerungen mehr als eine Annahme oder eine Vermutung sind, für die es an einer belastbaren Tatsachengrundlage fehlt und die daher nicht mehr als einen ‒ wenn auch schwerwiegenden ‒ Verdacht begründen.“
„Denn regelmäßig ist mit dem Inbrandsetzen der Wille kundgetan, das Gebäude nicht mehr als Wohnung zu benutzen . Eine solche Entwidmung nimmt dem Tatobjekt aber die von § 306a Abs. 1 Nr. 1 StGB vorausgesetzte Zweckbestimmung.“